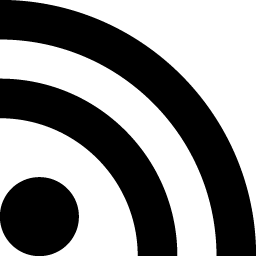Vor knapp einem Jahr hat die World Health Organisation die Entscheidung gefällt, die sogenannte Gaming Disorder in ihren Diagnosekatalog aufzunehmen. Als nicht-stoffgebundene Sucht sollen so spezifisch Personen diagnostiziert und therapiert werden, deren Spielverhalten über einen Zeitraum von zwölf Monaten exzessiv ist und dazu führt, dass andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Mit Prof. Dr. Anne Mette Thorauge vom Department of Media, Cognition and Communication an der Universität Copenhagen und Jurriaan van Rijswijk, dem Gründer und Vorsitzenden der Games for Health Foundation Europe, diskutieren wir über die Chancen und Gefahren der Gaming Disorder.
Außerdem geht es um den #metoo-Moment der Spielebranche, die Nintendo Switch und Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

Inhalt:
00:00:00 – 00:53:46 Spielewoche
00:53:46 – 01:42:20 Presseschau
01:42:20 – 02:15:45 Thema der Woche
Shownotes:
- Fans hinter der Absperrung (Petra Fröhlich)
- calling out my rapist (Nathalie Lawhead)
- Several high-profile game developers publicly accused of sexual assault (Andrew Webster)
- Two Women Accuse Skyrim Composer Jeremy Soule Of Sexual Misconduct (Cecilia D’Anastasio)
- Night in the Woods co-creator Alec Holowka has died (Owen S. Good )
- Politische Kommunikation als Monodrama: Axel Voss auf der Gamescom 2019 (Jennifer Schild)
Pixeldiskurs-Episoden und Artikel: