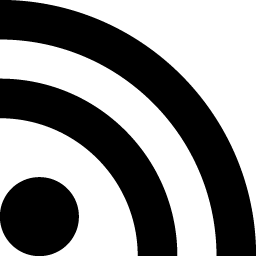In der vergangenen Woche entfaltete sich eine nicht ganz einfach zu durchschauende Situation um das Online-Magazin Kotaku. Während einige schon das Ende der Seite wahlweise zelebrieren oder betrauern, scheint die Lage durchaus unklar. Wir arbeiten die Ereignisse auf und diskutieren den Zusammenhang zwischen Spielejournalismus und politischen Diskursen.
Außerdem geht es um Man of Medan, schwarzen Humor und unsere Zukunft bei Springer.

Inhalt:
00:00:00 – 00:23:16 Spielewoche
00:23:16 – 00:50:00 Presseschau
00:50:00 – 01:30:00 Thema der Woche
Shownotes:
- das Programm der Clash of Realities-Tagung in Köln
- Rassismus, Sexismus, Fatshaming: “Schwarzer Humor” in Spielen (Pascal Wagner)
- Let’s Play: Goodbye Deponia (Gronkh)
- Debatte auf Steam zu Goodbye Deponia
- Wot I Think: Goodbye Deponia (John Walker)
- DIABLO 4 Trailer (Blizzard)
- Kotaku-Berichterstattung:
- G/O Media Tells Deadspin Staff in Leaked Memo: Stick to Sports (Maxwell Tani)
- Nach Protest von Mitarbeitern: Zukunft von Gaming-Blog Kotaku ungewiss (derstandard)
- der gelöschte kotaku-Artikel: A Note To Our Readers (Kotaku Staff)
- Funktion von Musik in Computerspielen (Shatiel)
- BlizzCon 2019’s biggest announcements: Diablo 4, Overwatch 2, and an apology (Charlie Hall)
- #84 – Musik, die Seele des Spiels (mit Julian Colbus)